Weiter, wilder, einsamer, fordernder
So ließe sich vielleicht am besten der zweite Teil unserer Durchquerung kurz in Worte fassen. Ziemlich genau 600 Kilometer und je ca. 46.000 Höhenmeter hoch und runter sind wir diesmal unterwegs gewesen. Rückenprobleme und mein OP bedingter Trainingsrückstand verbesserten sich schnell, ich konnte mich immer besser einlaufen und Cilli muss wohl irgendwo wie Obelix in einen Topf gefallen sein. Im Veltlin war ein Hüttenzustieg infolge der reißenden Gletscherabflüsse des Gletschers nicht direkt zu gehen. Im oberen Bergell zwangen uns Wegsperrungen aufgrund von Verschüttung und Murenabgängen zu tiefer gelegenen Umgehungen und Wiederaufstiegen. Ein Kälteeinbruch mit Schnee und Eis verhinderte die Besteigung des Piz Stella, ein ungewöhnlich starker, sehr kalter Wind pfiff sich mehrere Tage was auf Alpensüdseite. In diesem Teil des Alpenbogens müssen viele nach Süden fließende Flusstäler überschritten werden, mehrmals erzeugt das Relief tiefe Ab- und steile Aufstiege bis 2000 Höhenmeter.
Viele der Höhenwege, die wir alleine gegangen sind, lagen im Bereich T4/ T4+, forderten viel Aufmerksamkeit: brachten uns so viel kleinteiliges Erlebnis – aber nur wenige Richtungskilometer. Richtig nass wurden wir nur ein, zweimal – ansonsten konnten wir mit Wettervorausschau auch Hüttentage oder -nächte im Trockenen verbringen. Im Planungseifer im Frühjahr hatten wir uns aber nur 4 Ruhetage eingeplant. In Kombination mit Strecken über 20 Kilometer und gelegentlich je fast 2.000 Höhenmeter im Auf – und Abstieg – und das vor der letzten von uns geführten 9tägigen Tour mehrmals hintereinander – eine gewisse Müdigkeit am Ende der Durchquerung wurde schon spürbar. Trotzdem konnten wir auch diese letzten geführten Tage zusammen mit unseren TeilnehmerInnen, mit einigen ausgesetzten und langen weglosen Passagen durch Blockfelder gespickt, gut zu Ende bringen. Insgesamt haben wir auf den drei von uns geführten Touren insgesamt 13 TeilnehmerInnen oft technisch und vermutlich auch mental etwas Neues zeigen können, alle sind dabei gut mitgegangen.
Das war jetzt der „dramatische“ Teil. Aber natürlich gab es immer wieder: herrliche Blumenwiesen, verlockende Badegumpen, tolle Weitblicke, phantastische Farben, der Geruch von Lärchennadeln aus warmen mannshohen Ameisenburgen. Bilder von schönen Wegen im Auf- und Abstieg, Wälder, Felsen, Gras, Himmel…tausend Bilder, unbewusst abgespeichert, die sich dann nach Jahren als ein Deja vu freigeben.
Unterwegs manchmal viel Einsamkeit. Tage von Hütte zu Hütte fast ohne Menschen. Die Hüttenaufenthalte dann meist sehr herzlich und auch emotional echte „Ladestationen“. Meistens bewirtschaftete Rifugios, Selbstversorgerhütten und Bivaccos, Agriturimso und Bed&Breakfast, zwei kleinere Hotels und ein selbstverwaltetes Seminarzentrum – alle Übernachtungsformen waren dabei.
Wir waren dabei auf dem Sentiero Italia, dem Sentiero Bernina Sud, dem GTA, der Via Alpina blau und rot, dem Weg der Hirten, dem Sentiero Alpino Calanca, der Via Alta Vallemaggia, einem Stück der Via Alta Verzasca, der Alta Via Tullio Vidoni, der Alta Via delle Alpi Biellesi unterwegs. Und auf den vielen kleinen regionalen Wanderwegen, die das alles miteinander verbinden. Alle drei möglichen Gipfelbesteigungen, Piz Stella, Tagliaferro und Monte Mars, sind wegen schlechten Wetters ausgefallen.
Schon in der Vorbereitung beschäftigten wir uns bei der Recherche zur Reise mit folgenden Themen:
Schmuggelgeschichte/ Glaubenskrieg und „ Bloody Sunday Schweiz“ / Salecina, Theo Pinkus und der „Fichen“skandal/ Soglio/ Stausee Lago di Lei/ ehrenamtlicher Hüttenbetrieb im Tessin/ Hexenverfolgung in der Riviera/ Raubbau, Erosion, Emigration, Entvölkerung im hinteren Tessin, Neue Hoffnung Bergsteigerdörfer/ Partisanen Republik Ossola/ Verhinderte Sprengung des Simplontunnels/ Die Walser/ Zwangsarbeiter und Widerstand in Italien. Wir haben eine Menge gelernt und dann unterwegs auch wiedererkannt.
Teilweise sehr persönlich waren die spontanen Begegnungen auf den Hütten oder – dann meist kurz – auf dem Weg. Etwa mit dem jungen Schäfer aus Cottbus, der zum ersten Mal eine Herde voll verantwortlich übernimmt. Oder Fausto aus Locarno, der „Hüttenwart“ zu seinem Hauptberuf machen möchte, Matteo, der umsatteln will von der Sozialarbeit ins Leben eines professionellen Wanderleiters – die hohe Anziehungskraft der Berge, die auf uns ja auch wirkt, ist spürbar. Anders die Schweizer Familie, die nach dem anhaltenden nächtlichen Regen von der Tomeo Hütte anderntags voller Sorge absteigt – sie steht noch unter dem Eindruck der dortigen verheerenden Murengänge ein Jahr zuvor.
Ein paar Hütten später: „Die hohen Elektrozäune als Schutz vor Wölfen“, dann die Diskussion, ob man die überhaupt braucht, da sowieso das meiste Schaffleisch in der Schweiz aus Neuseeland komme – schnell sind wir zu sechst während des Abendessens beim Thema Globalisierung und Kapitalismus angelangt, der selbst in der traditionsgeprägten und auch reichen Schweiz die Almwirtschaft mit all ihrem Nutzen für den Erhalt der Biodiversität der ökonomischen Effizienz unterwirft.

Zurück in Mannheim. Dritte Augustwoche, 39°C, in der Innenstadt ist es wahrscheinlich noch heißer. Mir tun die leid, die hier jetzt arbeiten müssen. Selbst mich als Sportler macht das richtig platt, so eine Woche werde ich hier nicht noch einmal mitmachen! Die Klimakrise ist längst angekommen, wird hier verstärkt durch Mannheims traurigen Ruhm als Stadt mit der größten Versiegelung. Hier, sicher aus persönlicher Ignoranz Vieler, aber vor allem aus politischem Nichtstun, Lobbyismus und Populismus entsteht das Schmelzen der Gletscher. Wir können als Bergfreunde deshalb über Maßnahmen in der Bergen nachdenken und diese unterstützen – wir können aber zusätzlich vor allem auch einfach anfangen, vor der eigenen Tür zu kehren, uns engagieren, um hier Veränderungen einleiten und andere Rahmenbedingungen fordern.
Im Artikel „Vom Schmelzen alter Gewissheiten“ (im Themenheft Szene Alpen Nr 112/2025 von CIPRA) weitet auch Kaspar Schuler, der Geschäftsführer von CIPRA International den Blick von den sterbenden Gletschern der Alpen zu dem, was uns mit der schmelzenden Arktis erwartet. Außer in fernerer Zukunft um bis zu 7 Meter steigenden Meeresspiegeln kann es zu einem Stottern und dann Aussetzen der Nordatlantikströmung kommen, damit zu radikalen Klimaveränderungen. All das sehen wir kommen. Er schreibt auch: „Das Klima und auch der politische Diskurs laufen uns bedrohlich aus dem Ruder, ökologisch genauso wie demokratisch. Das 21. Jahrhundert wird unangenehm herausfordernd“.
Hiermit meint er das Anwachsen autoritärer bis faschistischer Strukturen. Schaut man genau hin, dann entstehen diese antidemokratischen Entwicklungen meistens aus der Öl- oder Gaslobby oder sind mit Finanzoligarchien verbunden, also Profitinteressen geschuldet. Wirkliche klimarelevante Lösungen sollten diese Zusammenhänge auch benennen. Eine Buchempfehlung dazu: „Toxisch reich“ von Sebastian Klein.
Seit dem Regierungswechsel werden statt einer demokratisch notwendigen Umverteilung jetzt wieder populistisch Kürzungen im Sozialstaat diskutiert. Die Förderung erneuerbarer Energien wird zurückgefahren, stattdessen an der Isar jetzt nach Gas gebohrt, aus jeder Diskussion wird populistische Volksverdummung gemacht. Offensichtlich ist dabei von manchen die mögliche Talsohle noch nicht erreicht.
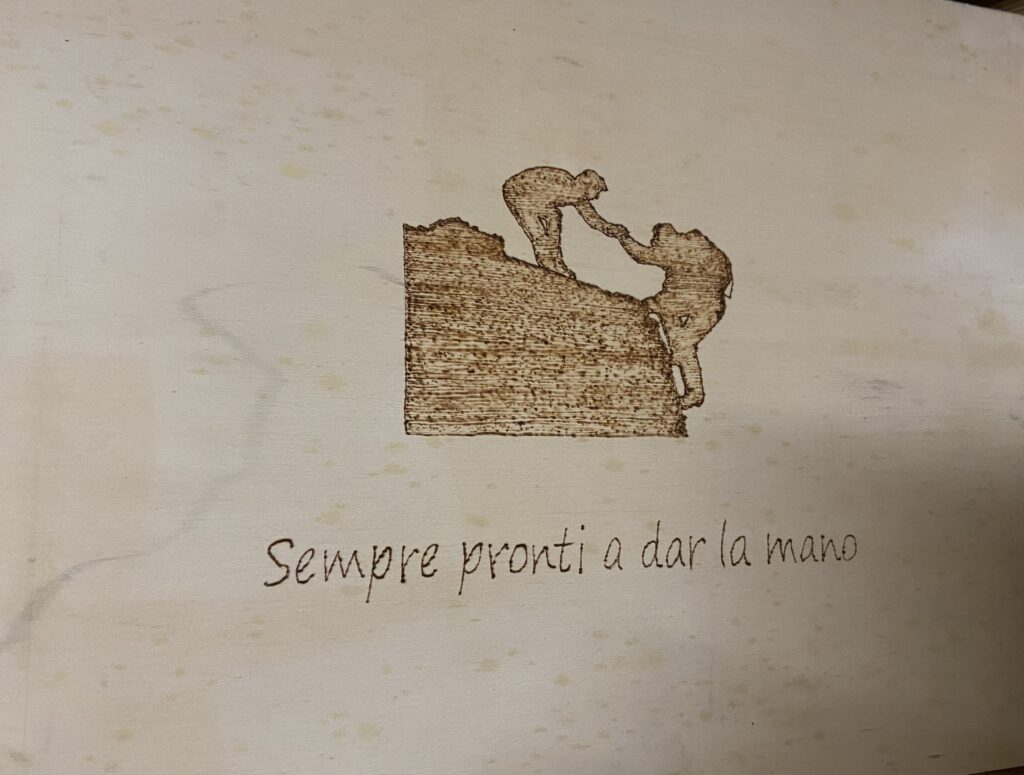
Wir richten uns darauf ein, das Geschehen eher kritisch zu begleiten. Ende September fahren wir deshalb zur DAV Werkstatt 2025 „Berge in Bewegung“ nach Leipzig. Mal sehen, wie die jüngsten Klimaentwicklungen im DAV diskutiert werden, ob es auch hier gelingt, über den Alpenrand hinaus zu blicken. Und gleichzeitig – fangen wir jetzt schon wieder an, das letzte Drittel der Alpendurchquerung zu planen! Wir freuen uns drauf!

